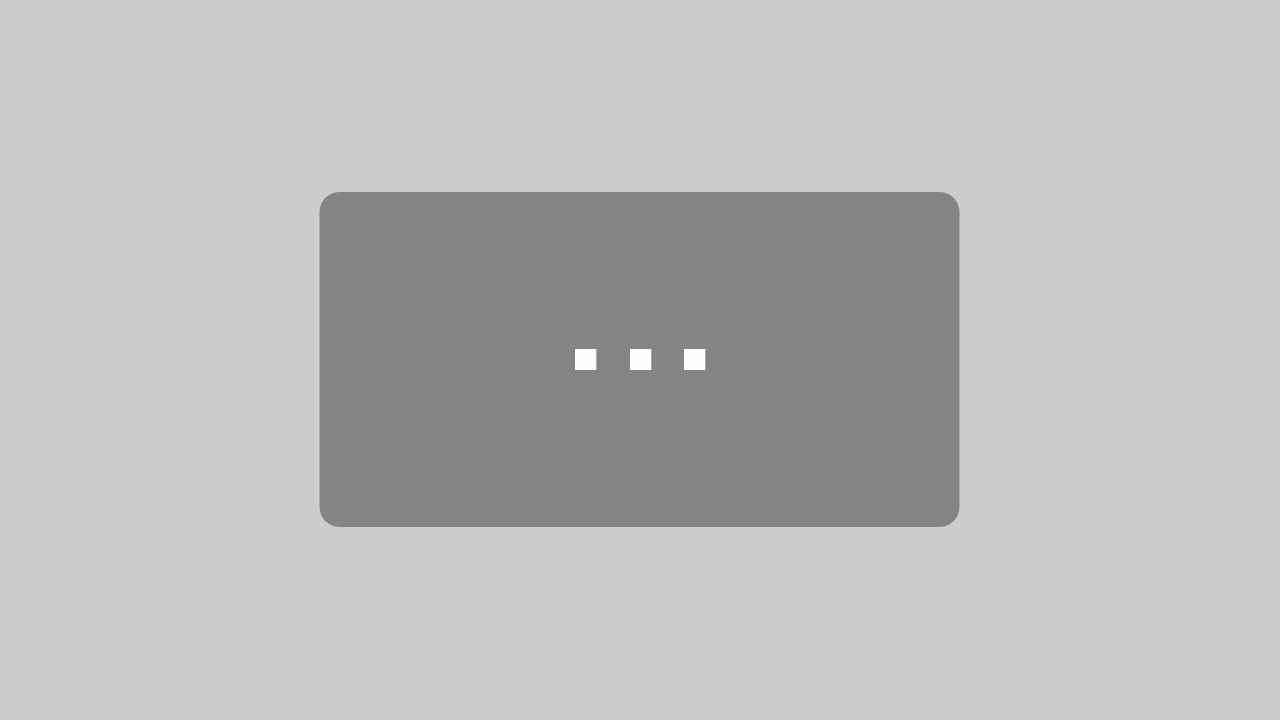Instagram bietet mit Insta-Storys und IGTV überraschende und kreative Möglichkeiten exklusiven Content zu publizieren. So raubt Instagram klassischen Medien allerdings auch existenzstiftende Reichweite und greift deren Geschäftsmodelle an.
Der Spiegel-Reporter Claas Relotius hat Inhalte für seine vielfach prämierten Reportagen erfunden oder verzerrt wiedergegeben. Das hat der Spiegel in seinem Heft Nr. 52 im Dezember 2018 offengelegt. Die Verantwortlichen sahen sich am „Tiefpunkt in der 70-jährigen Geschichte des Spiegel.“
Sie beschäftigen sich derzeit selbstkritisch, intensiv und transparent mit diesem Vorfall. Erste Erkenntnisse wurden bereits aufgearbeitet, Inhalte korrigiert bzw. neu recherchiert. Am Ende dieses Prozesses steht auch das Ziel, sicher zu stellen, dass so etwas nie wieder passieren wird.
Die spannenden Fragen aber bleiben: Wieso war Relotius so erfolgreich mit seinen falschen Reportagen? Warum sind Leser und sogar Qualitätskontrolleure so auf seine Arbeit abgefahren, dass ihnen nicht auffiel, wie sehr der Autor in die Fiktion abgeglitten war? Wieso hat er überhaupt dicker aufgetragen als die Realität es erlaubte? Und: Gibt es Alternativen zu seiner Flucht in die Fiktion, um die Aufmerksamkeit der Leser zu gewinnen?
Storytelling als Schlüssel zur Empathie des Publikums
Beim Lesen der vom Spiegel zitierten gefälschten Passagen erinnerte ich mich an ein Seminar, dass ich vor einigen Jahren bei Speaker-Coach Peter James Meyers besuchte. Meyers, der prominente Redner wie Al Gore schult und an der IMD Business School for Management in Lausanne lehrt, erklärte uns die wissenschaftlich begründeten Grundlagen für eine erfolgreiche Rede. Dabei gilt es, mit Sprache das Kino im Kopf des Publikums anzuschieben. Laut Meyers verarbeitet unser Gehirn Informationen auf vier unterschiedliche Arten: Wir sehen das Geschilderte vor unserem geistigen Auge („visual“), hören das Gesagte mit einem inneren Ohr („auditory“), bewegen uns in der Szene mit oder fühlen sogar imaginär Texturen („kinesthetic“) und „zählen“ Zählbares mit („digital“). Man könnte auch sagen: Diese vier – nennen wir sie „lautmalenden“ – Dimensionen fördern die Empathie des Publikums mit den Worten eines Autors.
Welches dieser vier „Stilelemente“ wie stark wirke, das sei bei jedem Mensch unterschiedlich und abhängig von seiner Rezeptionsfähigkeit, seiner Veranlagung oder auch von seiner momentanen Stimmung, so Meyers. „Finde heraus, wer im Publikum sitzt und sprich seine Sprache“, fordert der Coach von seinen Rednern. Claas Relotius, der junge Redakteur, hat genau dieses getan. Bewußt oder unbewußt hat er das komplette Empathieregister gezogen, um sein breites Publikum in den Bann seiner Stücke zu ziehen. Hier ein paar Beispiele:
Beispiel 1: Die letzte Zeugin“, erschienen im SPIEGEL am 3.3.2018.
„An einem späten Januarabend, der Himmel über Joplin, Missouri, ist ohne Mond, verlässt eine kleine zierliche Frau ihr Haus, um einen Mann, den sie nicht kennt, sterben zu sehen. Sie verriegelt die Tür, dreht den Schlüssel dreimal um, dann geht sie eine menschenleere Straße entlang, zum Busbahnhof. Sie besorgt sich ein Greyhound-Ticket für 141 Dollar nach Huntsville, Texas, und zurück. Sie hat nur eine Handtasche und einen leichten Rucksack mit einer Bibel, einer Zahnbürste und ein paar Keksen als Proviant dabei. Gayle Gladdis, 59, eine Frau mit schulterlangem Haar und Perlenohrringen, plant, nicht länger als 48 Stunden unterwegs zu sein, um das Böse aus der Welt zu schaffen.“
Beispiel 2: Der Einsatz von Musikzitaten
„Sträflinge stehen singend in Waschräumen oder ein verlorenes Kind geht eine dunkle Straße entlang mit einem traurigen Lied auf den Lippen.“ Relotius addiert in den Reportagen auch immer wieder Musik und Musikzitate. An einer Stelle erzählt er von Mouawiya, einem kleinen syrischen Jungen, der ihm einen Link zu einem YouTube-Musikvideo geschickt haben soll, das er nach dem Giftgasanschlag von Ghuta jede Nacht gehört habe: „Get Lucky“ von Daft Punk und Pharrell Williams („Ein Kinderspiel“, erschienen im SPIEGEL vom 23.6.2018). „Die Musik erweitert den Assoziationsraum der Geschichten, sie werden überwältigend sinnlich an diesen Stellen, sie geben der Fantasie der Leserschaft Futter. Das Schreiben fühlt sich dann filmisch an, es beginnt ein „Kino im Kopf“. In dieser Selbstkritik unterstreicht der Spiegel Meyers’ These.
Die Angst vor der Erlebnisarmut
Mitsehen, Mithören, Mitbewegen, Mitzählen – in wenigen Zeilen befeuert Relotius sprachlich all unsere „Sinne“. Dadurch, dass er viele dieser Elemente allerdings erfunden hat, hat er die Grenze von non-fiktionalem Reportage zu fiktionalem Storytelling überschritten – hat addiert, ohne seine Leser darauf hinzuweisen oder es als „Dokudrama“ zu kennzeichnen. Damit manipuliert er sein Publikum, das seine erdachten Details wie dargestellt dankbar aufgreift.
Hinter Relotius Fehltritten stand laut eigenen Aussagen seine Angst (Spiegel-Online), seine Reportagen könnten im Vergleich zur gewachsenen medialen Aufmerksamkeitskonkurrenz langweilig wirken und ihr Publikum so verfehlen. In gewisser Weise ist diese Angst nachvollziehbar. Denn Menschen sind fiktionsbedürftige Wesen, das unterscheidet sie laut Richard David Precht maßgeblich vom Tier (Video-Interview, ab Min 3:00). Der Mensch lebe aber heute effizienzkonditioniert in einer digitalen, durchgeplanten und unter Erlebnisarmut leidenden Gesellschaft, die, so Precht, mehr denn je nach überraschenden Storys frage und völlig „durchfiktionalisiert“ sei. Netflix und Co. dagegen setzen im Kampf um die begrenzte Aufmerksamkeitsspanne des Publikums auf digitale „Tricks“ im Storytelling. Sie nutzen AIgorithmen und künstliche Intelligenz um Storys gleich serienweise maßgeschneidert zu konfigurieren.
Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo argumentiert im Spiegelinterview gegen diese Angst: „Oft sind es doch die ganz nüchtern erzählten Beobachtungen, die berühren. Ich brauche da nicht das ganz große Drama.“
Dass Journalisten sich überhaupt als Storyteller begreifen, lehnt der US-amerikanische Journalist Jeff Jarvis in seinem Kommentar zum Fall Relotius sogar ganz ab. Im Vordergrund des Journalismus stehe aus seiner Sicht die Aufgabe, „Gemeinschaften zu einem zivilen, informierten und produktiven Gespräch zusammenzubringen“. Zuzuhören sei dabei oberste Pflicht des Journalisten. Storytelling gehöre nicht dazu, sondern bediene allenfalls persönliche Eitelkeit, so Jarvis.
Fakt ist andererseits aber auch: Mithilfe von Storytelling erklären wir Menschen uns die Welt. Wie das funktioniert, erklärt Anthropologin Polly Wiesner (in: Chris Anderson, TED TALKS) „…stories played a crucial role in helping expand people’s ability to imagine and dream and understand the minds of others.“
Die Grenze zwischen fiktionalem und non-fiktionalem Storytelling
Die Frage ist also: Hat Storytelling im Journalismus überhaupt Platz? Ein beeindruckendes Beispiel, wie die strikte Trennung von non-fiktionaler Reportage und Elementen des fiktionalen Storytelling aufgehoben werden kann, findet sich bei der New York Times.
Das erste Vorzeigeprojekt dieser Art, dem viele folgten, entstand nach einer kritischen Selbstanalyse zu Gründen ihrer dramatisch sinkenden Reichweite (nachzulesen im „Innovation„-Report der NYT). Die aus dieser Analyse entstandene eher experimentelle Online-Reportage „Snow Fall“ über ein Lawinenunglück sog das Publikum geradezu ins mehrteilige digitale „Scrollytelling“. Dafür betrieb man einen enormen digitalen Produktionsaufwand, interviewte Opfer und Zeitzeugen stilistisch in Szene gesetzt wie „Hollywood-Stars“, setzte Audio/Musik sowie atmosphärische Video-Stilelemente ein, nutzte redaktionell einwandfreie Texte und faktenbasiertes Karten- und Bildmaterial.
Die NYT schlägt einen richtungsweisenden Weg ein: Ein Team aus Storytellern, Digital Artists und Journalisten gewannen gemeinsam die Aufmerksamkeit ihres Publikums und konnten dabei sogar die Medien-Marke „NYT“ authentisch und zeitgemäß aufladen – ohne wie Relotius am Ende enttäuschen zu müssen. Aus diesem Beispiel lernen wir allerdings auch, dass dieser Schritt nur mit entsprechendem Aufwand, mit Mut zu neuen Wegen und Verantwortung funktioniert.
Fazit: Storytelling braucht Verantwortung
Mit Storytelling können wir Diskurse über Werte führen, die uns, ein Unternehmen, eine Marke und sogar unsere Gesellschaft ausmachen. Gute empathische Geschichtenerzähler klären auf, informieren, animieren und inspirieren, und können laut Chris Anderson (Buch: „TED TALK“) damit einen „besonders einflußreichen Status“ erlangen.
Wer Geschichten gut erzählen kann, bewegt also uns Menschen und wird mit unserer ganzen Aufmerksamkeit belohnt. Das liegt in unserer Natur. Damit trägt er zugleich auch eine große Verantwortung für sein Publikum – und am Ende auch für die Gesellschaft, in der wir leben.